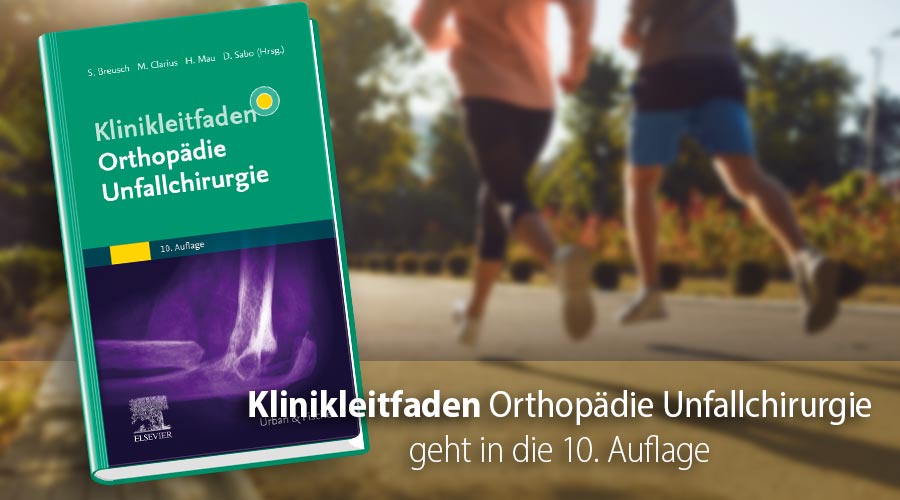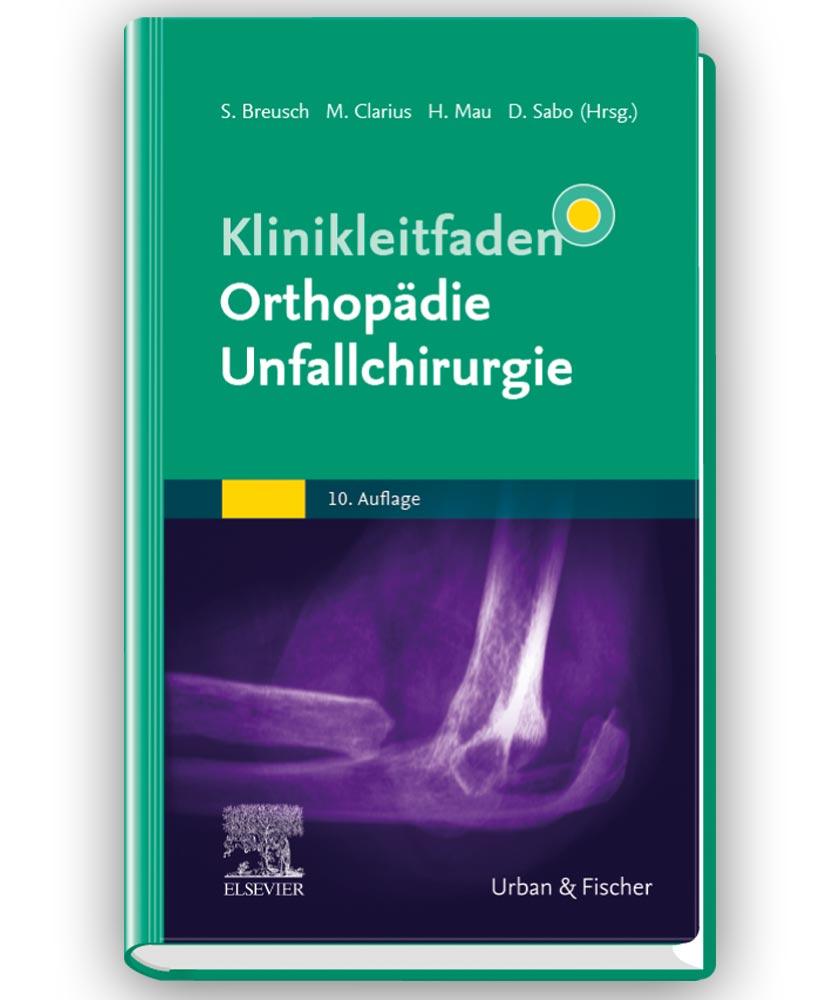6. Heidelberger Arthrosetag: Ein Tag für Ihre Gelenke

Der 6. Heidelberger Arthrosetag steht vor der Tür und verspricht ein informatives Ereignis für alle, die an Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Gelenke interessiert sind.
Bei Arthrose handelt es sich um eine Gelenkerkrankung, die Millionen von Menschen weltweit betrifft. Sie kann Schmerzen, Entzündungen und eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke für die Betroffenen mit sich bringen und dadurch zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen. Obwohl Arthrose meist im Alter auftritt, kann sie auch jüngere Menschen betreffen, gerade wenn sie einer übermäßigen Belastung oder Verletzungen ausgesetzt sind.
Die SPORTOPAEDIE Heidelberg und die Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin des St. Josefskrankenhauses bieten mit dem 6. Heidelberger Arthrosetag Interessierten die Gelegenheit, sich von führenden Experten über die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Arthrose von Knie-, Hüft- oder Schultergelenk informieren zu lassen. Die Teilnahme am 6. Heidelberger Arthrosetag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Das Programm
10:00 Uhr: Das künstliche Kniegelenk – Dr. med. Lars Hübenthal
10:30 Uhr: Das künstliche Hüftgelenk – Dr. med. Joachim Weber
11:00 Uhr: Das künstliche Schultergelenk – Dr. med. Michael Koch
11:30 Uhr: Sicher und schmerzfrei durch die Operation – Dr. med. Tom Terboven
Teilnahmeinformationen
Datum: 4. November 2023
Uhrzeit: 10:00–12:00 Uhr
Veranstaltungsort: Refaktorium im St. Josefskrankenhaus (4. OG, Raum 469), Landhausstraße 25, 69115 Heidelberg
Wir freuen uns darauf, Sie beim 6. Heidelberger Arthrosetag zu begrüßen. Kommen Sie einfach vorbei und nehmen Sie an diesem informativen Tag teil. Ihre Gelenke werden es Ihnen danken!